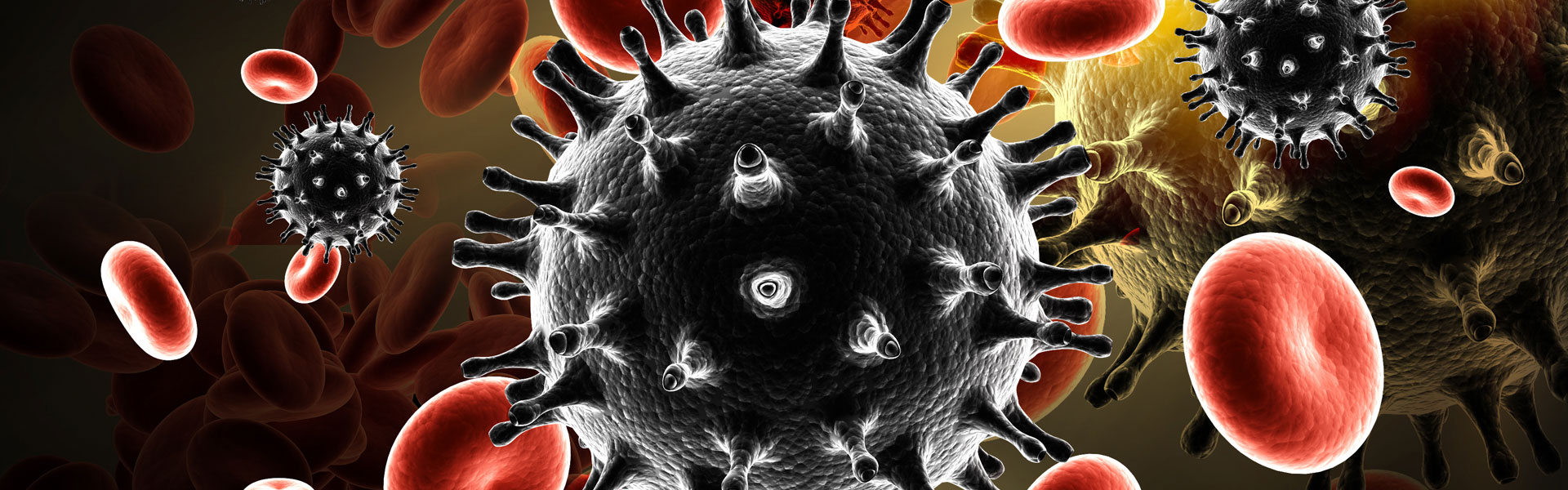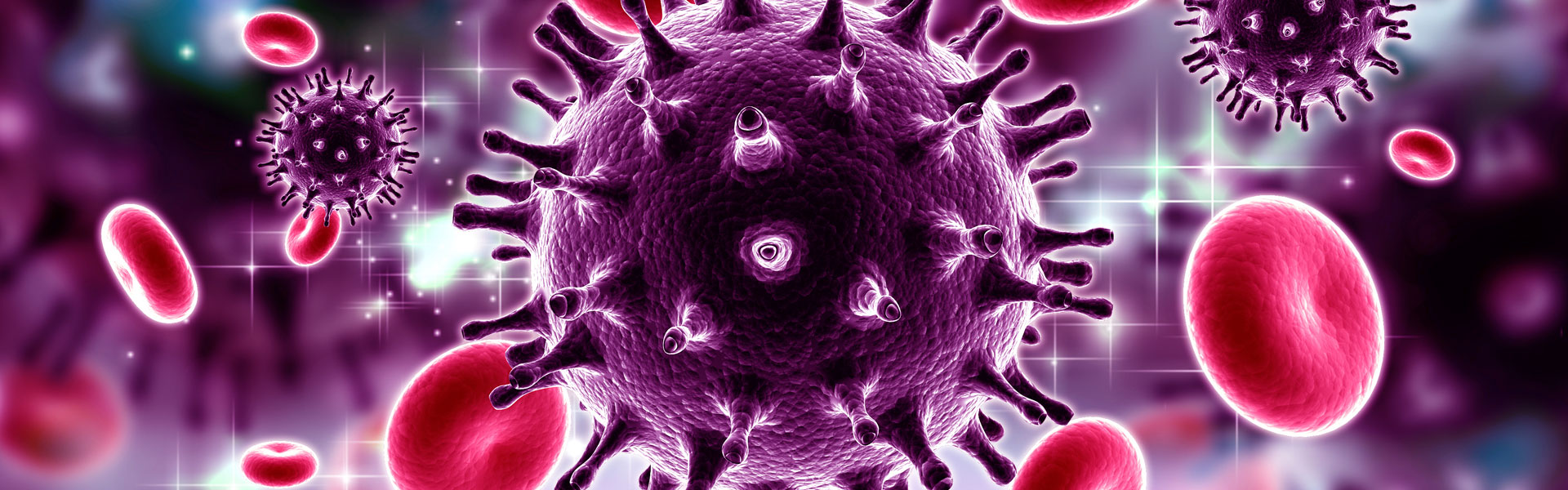Die Wissenschaftskommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der Forschung. Ohne sie wäre der Transfer von neuen Erkenntnissen aus der Forschung in die Praxis nicht möglich. Insbesondere im Angesicht der Coronavirus-Pandemie wird klar, wie wichtig eine „gute“ Wissenschaftskommunikation ist und dass diese sehr viel komplexer sein kann, als viele anfangs vermuten. „Es geht […] nicht nur darum, verständlich zu erklären, was ein Virus ist. Es geht um viel mehr“, sagt Frau Prof. Dr. Leßmöllmann. Sie ist Professorin für Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Linguistik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Davor bekleidete sie bereits die Professur für Journalistik mit dem Schwerpunkt Wissenschaftsjournalismus an der Hochschule Darmstadt, arbeitete als freie Wissenschaftsjournalistin und war Redakteurin bei Gehirn&Geist/Spektrum der Wissenschaft. Mit ihr haben wir über Wissenschaftskommunikation in der heutigen Zeit gesprochen.
Frau Prof. Leßmöllmann, Sie bekleiden den Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Linguistik am KIT. Was genau versteht man unter Wissenschaftskommunikation und warum ist diese wichtig?
Leßmöllmann: Wissenschaftskommunikation umfasst alle Kommunikationsformen, die sich auf wissenschaftliche Forschung, ihre Methoden, ihre Produkte und Ergebnisse, aber auch ihre gesellschaftlichen Implikationen beziehen. Das ist zunächst mal die interne Wissenschaftskommunikation, die formal stattfinden kann (z.B. ein journal paper) oder informell (z.B. ein Gespräch in der Kaffeepause unter Forscher*innen eines Instituts, aber auch Whatsappgruppen oder Weblogs, in denen Wissenschaftler*innen miteinander kommunizieren. Dann gibt es die externe Wissenschaftskommunikation, die eine Vielzahl von Kanälen, und sowohl digitale als auch analoge Formate umfasst. Sie kann durch verschiedene Akteur*innen ausgeführt werden: von Wissenschaftsjournalist*innen über die strategische Wissenschaftskommunikation bis hin zu Museen oder Science Centers. Außerdem gibt es einzeln kommunizierende Wissenschaftler*innen, die auch digitale Formate nutzen können – denken Sie an den Podcast von Christian Drosten. Angrenzende Bereiche der Wissenschaftskommunikation sind z.B. die Politikberatung oder die universitäre Lehre, aber auch die Schulen, zu denen es zahlreiche Überscheidungen gibt.
Wichtig ist Wissenschaftskommunikation, weil sie alle – Bürger*innen, Politiker*innen, Firmenchef*innen, NGOs etc. – ins Gespräch über Wissenschaft bringt: ihre Ergebnisse, ihre Methoden, ihre Denkweisen. Wer sich mit Wissenschaft beschäftigt, hat ein sehr mächtiges Werkzeug in der Hand, das hilft, für den Alltag oder für die Politik, aber auch der Wirtschaft, Schlüsse zu ziehen und Entscheidungen vorzubereiten. Dazu muss klar sein, dass die Wissenschaft sehr viel Unwissen oder Unsicherheit produziert, das ist ihr Job. Sie ist keine Faktenmaschine, sondern erzeugt Erkenntnisse, die sich über eine lange Prüfphase zu Fakten formen lassen, die dann in Lehrbüchern stehen. In Zeiten der wissenschaftlichen Unsicherheit – Stichwort Corona – kann die Wissenschaft also häufig nicht die harte Faktenbasis liefern, die sich z.B. die Politik wünscht. Das zu verstehen, zu akzeptieren und vor allem, damit umzugehen, ist ein ganz wichtiger Gegenstand, aber auch ein Ziel der Wissenschaftskommunikation. Es geht also nicht nur darum, verständlich zu erklären, was ein Virus ist. Es geht um viel mehr. Es geht um einen Dialog mit allen potentiellen gesellschaftlichen Adressat*innen darüber, wie Wissenschaft arbeitet und wie sie zu einer guten Grundlage für Orientierungswissen in dieser komplexen Welt wird.
„Wissenschaftler*innen stehen heute immer mit einem Bein in der Öffentlichkeit“
Das Bild des still in seinem Kämmerchen vor sich hin forschenden Wissenschaftlers gehört schon länger der Vergangenheit an. Heutzutage ist die Vernetzung in der Wissenschaft und das internationale Präsentieren und Publizieren der eigenen Arbeit essentiell geworden. Wie hat sich die Wissenschaftskommunikation in den letzten Jahren gewandelt, auch in Hinblick auf Soziale Medien?
Leßmöllmann: Wissenschaftler*innen stehen heute immer mit einem Bein in der Öffentlichkeit. Wenn Virolog*innen ein Ergebnis auf einem Preprint-Server hochladen – womit sie den Startschuss für eine innerwissenschaftliche Diskussion abgeben –, dann kann das heute von Journalismus und Öffentlichkeit wahrgenommen, aufgegriffen, diskutiert werden. Und auch, wie es ja die BILD-Zeitung tat, versuchsweise gegen ihn verwendet werden. Das heißt, innerwissenschaftliche Kommunikation auf digitalen Plattformen, oder Lehre, die auf YouTube hochgeladen wird, etc. – landen ganz schnell in der externen Wissenschaftskommunikation. Die Sphären sind nicht mehr strikt getrennt. Deshalb sollten sich Wissenschaftler*innen sehr gut mit Medien, aber auch mit der Gesellschaft auskennen. Denn es geht hier nicht nur darum, mit medialen Tools gut umzugehen. Sondern auch darum zu begreifen, wie Menschen heute leben, welche Ängste sie haben, wie sehr für sie wissenschaftlicher Fortschritt oder technische Innovation relevant ist. Wir leben nicht mehr in der 1950ern, wo man durch technologische Versprechungen kommunikative Resonanz erzeugen konnte. Wissenschaft lebt ja immer von einem Zukunftsversprechen: „Wir werden eine Lösung finden, wir werden ein Produkt erzeugen.“ Doch dieses Zukunftsnarrativ stößt heute auf ganz andere gesellschaftliche Resonanzböden als früher.
Und das bekommt man als kommunizierende Wissenschaftler*in zu hören oder zu spüren, auch in den Sozialen Medien. Sie können ein großartiger Kommunikationsraum sein, aber es können sich dort auch Abgründe auftun. Bei der Kritik an den Sozialen Medien halte ich es aber für wichtig, nicht nur die Echokammer- und Filterblaseneffekte zu beachten, die durch sie durchaus erzeugt werden können. Sondern sich auch zu fragen: Wieso ziehen sich Menschen, z.B., in pseudowissenschaftliche Zirkel zurück? Wieso fühlen sie sich dort sicher aufgehoben, bestärkt – und wieso nicht in wissenschaftlichen Zirkeln? Solchen Fragen muss sich die Wissenschaftskommunikation stellen.
„Wissenschaft ist keine Wahrsagebox, in die man eine Münze reinwirft, und unten kommt die Antwort raus.“
In Gesprächen mit Freunden und Familie erlebt man oft eine große Diskrepanz zwischen der Forschung und den in der Gesellschaft gestellten Ansprüchen an die Forschung. Während sich Wissenschaftler*innen nie zu 100 Prozent sicher sind und ihre Einschätzungen häufig aufgrund neuer Erkenntnisse anpassen müssen, möchte die Gesellschaft klare und schnelle Antworten, z.B. darauf wie sich Forschungsergebnisse in der Praxis anwenden lassen. Wie sollte man diesem Unterschied begegnen?
Leßmöllmann: Das ist die riesige Herausforderung. Es geht nur, indem man deutlich macht, dass die Wissenschaft so nicht arbeitet. Stattdessen müssen Politik und Bevölkerung es schaffen, aus den Möglichkeitsräumen, die die Wissenschaft aufspannt, die richtigen Schlüsse für etwaige Umsetzungen zu ziehen. Ich würde auf Ihre Frage so antworten: Wissenschaft ist keine Wahrsagebox, in die man eine Münze reinwirft, und unten kommt die Antwort raus. Sondern sie ist ein sehr komplexes Gebilde, aus der sich mit der Zeit einige Ergebnisse herausarbeiten lassen, die dann auch nutzbar sind. Eigentlich ist es doch eine Stärkung der Gesellschaft und auch der Politik, dass sie aktiv mit der Forschung in Dialog tritt und dann herausarbeitet: Welche Schlussfolgerungen ziehen wir jetzt aus diesen Ergebnissen? Was ist das Beste für die Gesellschaft? Es wäre ja auch eine Form von Unmündigkeit, aus der Wissenschaft einfach nur Ergebnisse abzufragen und die dann umzusetzen. So einfach funktionieren komplexe Gesellschaften nicht. Gerade in Corona-Zeiten leben wir ein tägliches, stündliches Experiment. Anstatt darüber zu lamentieren, sollten wir das offensiv angehen, über die wissenschaftlichen Ergebnisse diskutieren und unsere Schlussfolgerungs- und Entscheidungsmuskel trainieren - sowohl im Alltag als auch in der Politik - anstelle zu jammern, dass die Wissenschaft keine Fakten liefert.
„Titel und Teaser [müssen] viel, viel, viel genauer und sorgfältiger geschrieben werden.“
Die Systeme Wissenschaft und Journalismus unterscheiden sich wesentlich voneinander. Christian Drosten, Virologe an der Charité, hat sich in der Vergangenheit über die starke Verkürzung seiner Aussagen und irreführende Schlagzeilen beschwert (NDR Podcast: Coronavirus-Update). Ist eine Wissenschaftskommunikation über die gängigen Medien (Fernsehen, Zeitungen) grundsätzlich überhaupt möglich? Wie sehen Sie das?
Leßmöllmann: Ja, sie ist möglich, absolut, der Wissenschaftsjournalismus hat gerade in Corona-Zeiten einen hervorragenden Job gemacht, auch wenn es im Einzelnen zu Recht Kritik gab. Aber: Es müssen handwerkliche Dinge verbessert werden. Menschen lesen häufig nur Titel und Teaser, die über die sozialen Medien verbreitet werden. Sie sind das Schaufenster des Journalismus, die Menschen denken: Die Leser*innen denken: Was z.B. in einem Facebook-Post der Tagesschau steht, das ist der Fall, und danach beurteile ich den Artikel (auch wenn ich ihn nicht gelesen habe), oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen, oder überhaupt den ganzen Journalismus. Das ist fatal und bejammernswert, aber nicht zu ändern. Deshalb müssen Titel und Teaser viel, viel, viel genauer und sorgfältiger geschrieben werden. Nicht auf Clickbait, sondern auf die Angemessenheit der Sachlage hin angepasst und in Absprache mit der Autorin oder dem Autor des Textes, auf den mit dem Teaser hingewiesen wird. Und schon gar nicht dürfen Social-Media-Redakteur*innen das, was im Artikel steht, überzeichnen oder sogar ins Gegenteil verkehren. Das untergräbt das Vertrauen in den Journalismus. Sie haben also eine sehr große Verantwortung. (Das gilt aber übrigens auch für die PR-Abteilungen der wissenschaftlichen Institutionen, die ja ebenso Teaser oder Social-Media-Posts schreiben – da darf auch nicht übertrieben oder verzerrt werden.)
Aber: Der Journalismus hat bestimmte Systemlogiken und damit handwerkliche Standards, die er nicht ignorieren kann. Ein Teaser, auch wenn er im oben genannten Sinne hervorragend gemacht wäre, ist immer noch ein Teaser, und kein wissenschaftliches Paper. Er muss bestimmte Dinge verkürzen und er muss Neugier wecken und Lust aufs Weiterlesen erzeugen. Er wird für die Augen einer Forscherin daher häufig zu ungenau sein. Nicht jede Ungenauigkeit ist aber gleich eine unverzeihliche Verzerrung. Da müssen auch Wissenschaftler*innen genau hinschauen: Wo werden sie falsch dargestellt, und wo „nur“ journalistisch zugespitzt, aber dennoch verzeihlich? Ich habe Christian Drostens Medienkritik unter anderem auf Twitter intensiv verfolgt, und ganz häufig hat er Recht. Aber bei der einen oder anderen Kritik an Teasern hat er, bei allem gebührenden Respekt, auch nicht Recht. Deswegen ist die qualifizierte Auseinandersetzung mit Medien und ihre Logiken so wichtig für Forschende, insbesondere in leitenden und medial prominenten Funktionen.
„Die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft kann leiden, wenn sie interessensgeleitet agiert.“
In der Kommunikation von Forschungsergebnissen kann auch einiges schiefgehen, wie wir gerade erst bei der sogenannten „Heinsbergstudie“ sehen konnten. Was raten Sie Wissenschaftler*innen für eine gute Wissenschaftskommunikation?
Leßmöllmann: Sie sollten sich nicht in den Dienst der Politik stellen. Wenn eine bestimmte politische Entscheidung vorgegeben oder gewünscht ist, dann ist das aus politischer Sicht vollkommen berechtigt. Aber die Forschung muss frei sein, um Ergebnisse zu produzieren, die vielleicht dieser politischen Richtung entgegenstehen. Die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft kann leiden, wenn sie interessensgeleitet agiert.
„[…], es ist auch klar geworden, dass es bei Wissenschaftskommunikation nicht nur um verständliche Vermittlung geht.“
Was bedeutet die Coronavirus-Pandemie und das daraus resultierende gesteigerte Interesse an der Forschung für die Wissenschaftskommunikation? Hat sich hierdurch etwas verändert?
Leßmöllmann: Wissenschaftskommunikation und ihre Erforschung sind noch stärker auf die Agenda gerückt als vorher. Ich denke, es ist auch klar geworden, dass es bei Wissenschaftskommunikation nicht nur um verständliche Vermittlung geht. Es geht auch darum, in den durchaus konfliktreichen Dialog zu treten mit Menschen, die die Wissenschaft ablehnen oder wissenschaftlich motivierte politische Entscheidungen als undemokratisch einschätzen. Wie nah Wissenschaftskommunikation an demokratietheoretische Fragen einerseits und an Fragen der gelungenen, guten Politikberatung andererseits herangerückt ist durch die Corona-Krise, das hat sicherlich die Aufmerksamkeit noch einmal erhöht. Viele andere Fragen, also die nach der Glaubwürdigkeit von wissenschaftlichen Expert*innen und der Frage, wie mit Verschwörungsmythen umzugehen ist, sind noch viel virulenter geworden. Ich erhoffe mir eine verstärkte Forschung, aber auch Praxisreflexion in Bezug auf die Frage, was eigentlich passiert, wenn Wissenschaftskommunikation schlecht gemacht wird oder schief geht, und wie sie überhaupt möglich ist in der aktuellen Medienwelt.
„Nachwuchswissenschaftler*innen werden zu wenig vorbereitet.“
Inwieweit ist der wissenschaftliche Nachwuchs auf eine gute Wissenschaftskommunikation vorbereitet? Sehen Sie hier Bedarfe in der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftler*innen?
Leßmöllmann: Sie werden zu wenig vorbereitet. Reflexionswissen über das Zusammenspiel oder auch die Konflikte zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist zu wenig vorhanden, auch das aktuelle Mediensystem wird zu wenig reflektiert. Da könnte man noch deutlich nachlegen.
Frau Prof. Leßmöllmann, wir danken Ihnen vielmals für das Gespräch!
Interview: Dr. Dana A. Thal im Auftrag für die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen