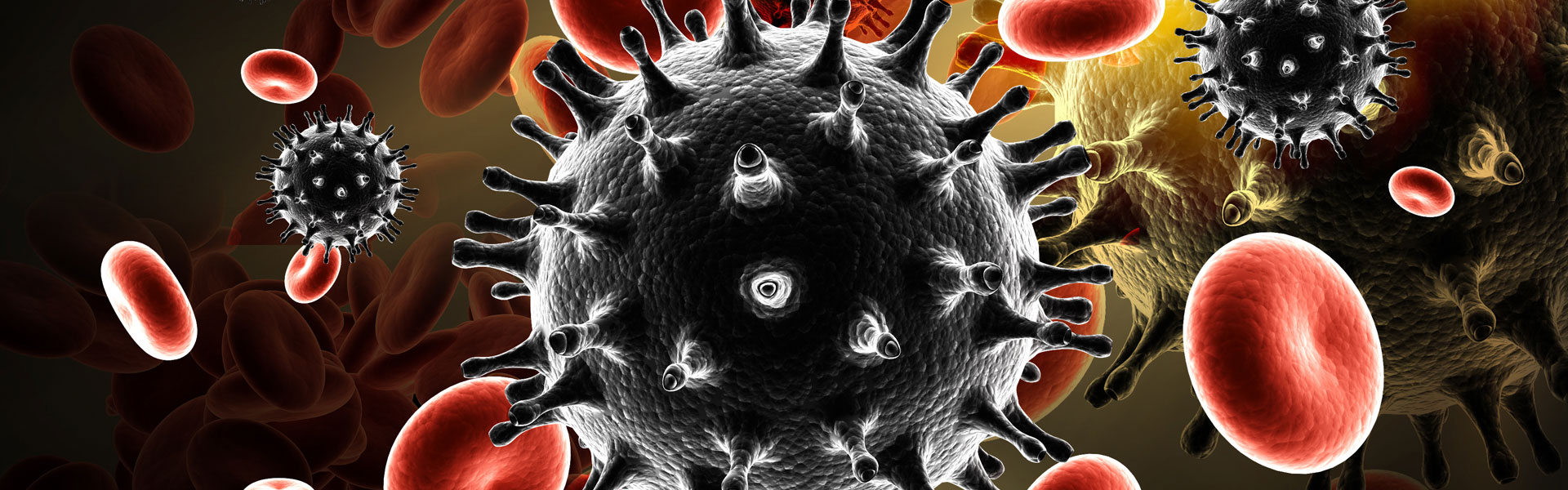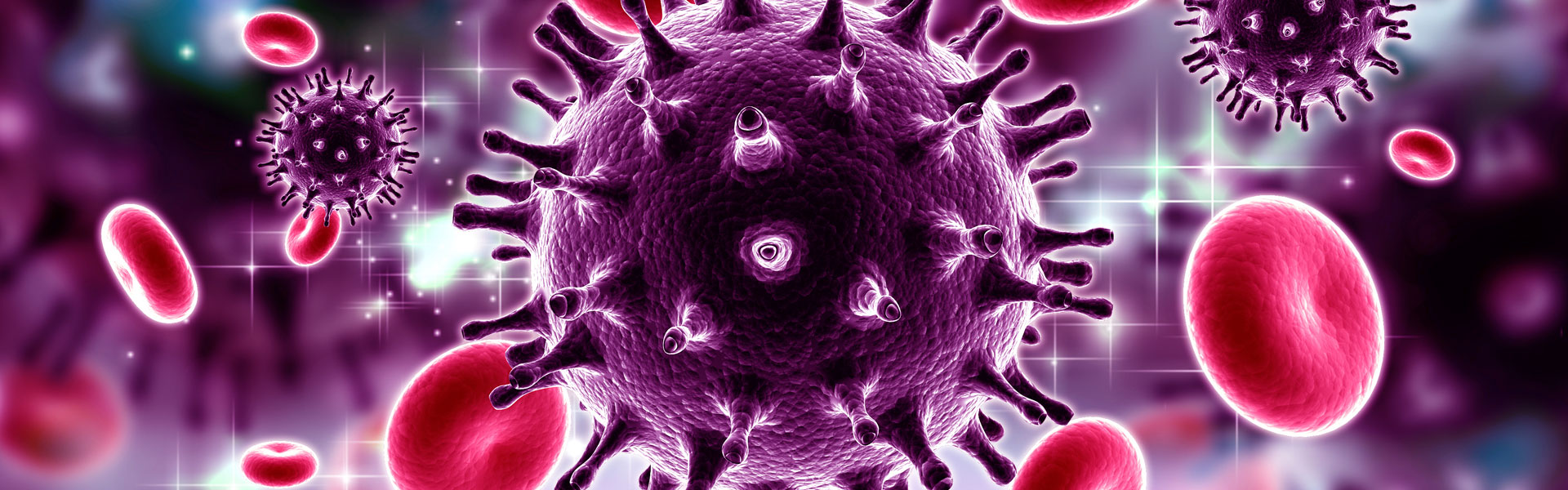Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit über die Kooperation zwischen Human- und Tiermedizin und die Entdeckung eines neuen Borna-Virus

Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, Bernhard-Nocht-Institut, Hamburg (© Alex Tomazatos)
Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit leitet am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin die Virusdiagnostik und eine Arbeitsgruppe, die sich mit Arboviren beschäftigt. In einer seiner jüngsten Publikationen im New England Journal of Medicine geht es jedoch um ein neues Borna-Virus, das von Bunthörnchen auf Menschen übertragen wurde.
Prof. Dr. Schmidt-Chanasit, worum geht es in der Publikation?
Es gab eine lange Diskussion, ob Borna-Viren Menschen krank machen können aber seit nunmehr 10 Jahren hatte man sich darauf geeinigt: Nein, Borna-Viren sind nicht humanpathogen. Unsere Studie liefert nun erste Hinweise, dass dieses neue Borna-Virus humanpathogen ist. Das betrifft allerdings nicht das bisher bekannte, klassische Borna-Virus, das hauptsächlich Pferde krank macht.
Was hat das für Konsequenzen?
Wir haben ein komplett neues Borna-Virus entdeckt, das man vorher nicht kannte. Das neu entdeckte Borna-Virus ist ganz anders: Es wurde bei Menschen und Tieren nachgewiesen, genauer gesagt, bei Bunthörnchen und drei Patienten, die an einer Gehirnentzündung verstorben sind. Das Fass ist somit jetzt neu aufgemacht worden. Jetzt muss man schauen, ob es doch noch andere Borna-Viren gibt, die eine Relevanz für Menschen haben. Deswegen schaut man breiter, auch in anderen Nagetieren oder Insektivoren, also Insektenfressern. Das ist nicht mein hauptsächlicher Forschungsschwerpunkt, aber weil ich für die Diagnostik verantwortlich bin, haben wir jeden Tag Proben von ungeklärten Todesfällen auf dem Tisch.
Es waren ja verschiedene Wissenschaftler an der Studie beteiligt – wie kam das?
Die Identifizierung des neuen Borna-Virus ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und dem Friedrich-Loeffler-Institut. Da haben sich auf ideale Weise Humanmediziner, Veterinäre und Biologen miteinander verbunden, so wie man sich das in der Zoonosenforschung auch vorstellt. Und aufgrund dieser intensiven Zusammenarbeit war es auch nur möglich, dieses neue Borna-Virus zu entdecken.

Jagd auf Stechmücken
(© Alex Tomazatos)
Und wie kam die Geschichte ins Rollen?
Drei Patienten waren an einer Gehirnentzündung verstorben, aber man konnte die Ursache diese Erkrankung nicht aufklären. Wir Humanmediziner haben die Verstorbenen mit verschiedenen Methoden untersucht, aber alle Untersuchungen waren negativ und somit war für uns dann die Sache erledigt. Aber alle drei Patienten hatten Bunthörnchen gezüchtet und die Kollegen, die Veterinärmediziner, haben eines dieser Tiere untersucht. In diesem Tier wurde das neue Borna-Virus entdeckt. So konnte man die Patientenproben dann retrospektiv auch darauf untersuchen und wir haben das neue Borna-Virus dort auch gefunden und anschließend weiter charakterisiert.
Die Patienten hatten sich also vermutlich durch die Hörnchen infiziert?
Genau. Das zeigt sehr schön, was heutzutage das große Problem ist und warum die Zoonosenforschung so wichtig ist: Die betroffenen Patienten waren alle Züchter von exotischen Hörnchen, die normalerweise Wildtiere sind und schon gar nicht nach Deutschland importiert werden sollten. Aber das ist für manche eben ein ausgefallenes Hobby. Und wenn man mit diesen Tierchen, die normalerweise in Mittelamerika durch den tropischen Regenwald hüpfen, zu tun hat, dann kann es eben dazu kommen, dass man erkrankt und verstirbt. Für Szenarien mit neuen Erregern gibt es ja noch andere Beispiele, denn die natürliche Grenze zwischen Mensch und exotischen wilden Tieren, die es früher gab, wird immer mehr durchbrochen.

Hund mit Stechmücken
(© Alex Tomazatos)
Wie einfach oder schwierig war denn die Zusammenarbeit von all den unterschiedlichen Wissenschaftlern?
Die war sehr gut. Das außergewöhnlich Gute an der Kooperation war erst einmal: Wir kennen uns natürlich, wir arbeiten schon seit mehreren Jahren zusammen. Das Wichtige ist, dass man sich bei solch umfangreichen Studien vertraut und dass man nicht das Gefühl hat, der eine nimmt dem anderen irgendetwas weg. Dieses Grundverständnis war da und das hat auch erst die Offenheit ermöglicht, bezüglich Ergebnissen, Probenaustausch usw. Dieser Austausch, der ist nur möglich, wenn man weiß: Man wird nicht über den Tisch gezogen.
Und das „timing“ ist natürlich sehr wichtig. Wenn das eine heiße Sache ist, dann muss auch alles andere stehen und liegen gelassen werden, um die notwendigen Untersuchungen in wenigen Tagen abschließen zu können. Sonst sind die anderen schneller. Die Konkurrenz schläft ja nicht.
Das war auch hier ganz hervorragend. Es kam zu keiner Verzögerung, weil alle wussten, das ist ein ganz heißer Fall! Das ist endlich der Beweis, dass Borna-Viren Menschen krank machen können, und dadurch wird die ganze Virus-Familie auf einmal viel interessanter für die Zoonosenforschung. Und nur dadurch ist es dann so gut publizierbar gewesen. Und Publikationen sind die internationale „Währung“, mit der der Forschungswert bemessen wird.
Dank unserer Zusammenarbeit konnten auch die Veterinäre hochrangig publizieren, wie sich mit der Veröffentlichung im New England Journal of Medicine gezeigt hat. Wir haben die ganzen Daten zusammengelegt: Patientendaten, Tierdaten usw. Nur damit hat man die Möglichkeit in Journals wie Lancet oder New England Journal of Medicine zu kommen. Dieser interdisziplinäre Ansatz biete genau diese Möglichkeit, das ist ganz toll. Sonst fehlen immer Puzzleteile. Und natürlich kommt diese interdisziplinäre Zusammenarbeit auch den Angehörigen der verstorbenen Patienten zu Gute: Es konnten weitere Infektionen vermieden werden und die Todesursache wurde aufgeklärt.
Dann ist Vertrauen also so wichtig wie Pipette und Skalpell?
Vertrauen ist das Wichtigste: Das alle das Gefühl hatten, ihre Arbeit wird gewürdigt, sie werden nicht hintendran gestellt oder bei der Publikation vergessen. Aber das hat sich nicht in einer Woche ergeben, sondern wir kannten uns schon.
Der persönliche Kontakt ist eben wichtig und da ist die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen ideal dafür. Alle sind auch immer begeistert, wenn das Nationale Symposium für Zoonosenforschung in Berlin stattfindet. Viele ärztliche Kollegen, die ich mitgebracht habe, haben gesagt: „So ein tolles Symposium, das ist so offen. Da sitzt der Student neben dem Professor, da kann man ganz offen diskutieren und Sachen besprechen, ohne auf die Hierarchie Rücksicht nehmen zu müssen.“
Das Motto des nächsten Zoonosensymposiums lautet „Research meets Public Health“ – was versprechen Sie sich davon?
Da fokussieren wir mehr auf den öffentlichen Gesundheitsdienst, den ÖGD. Das ist ganz wichtig. Wir müssen mit den Leuten vom ÖGD zusammenkommen, da sollte noch eine stärkere Vernetzung stattfinden. Oft wird der ÖGD durch die klinisch tätigen Kollegen – aber auch durch viele Grundlagenwissenschaftler – in so eine Ecke gestellt: „Das sind ja nur solche Verwaltungstypen, die ein paar Erbsen zählen“. Aber ich sag das auch immer in den Vorträgen: Das stimmt nicht. Man erreicht nur in Zusammenarbeit mit dem ÖGD eine Stufe, die wirklich exzellente Forschung ermöglicht, insbesondere im Bereich der neu auftretenden Erreger in Deutschland. Ein Beispiel: Der erste autochthone Dengue-Virus Fall in Japan seit dem 2. Weltkrieg ist nur mit Hilfe des ÖGD in Deutschland diagnostiziert worden und wurde danach hochrangig publiziert. Und ich könnte noch weitere Beispiele nennen, wo wichtige Fälle nicht diagnostiziert worden wären ohne den ÖGD. Deswegen finde ich es wichtig, dass man die ärztlichen Kollegen dort auch besser versteht: Was machen die eigentlich, was brauchen die von uns? Dazu findet ja die Tagung im Oktober statt, das ist schon mal sehr gut.
Was würden Sie sich von oder für die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen wünschen?
Als Traum: Die Stärkung der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen. Weil wir genau so eine Plattform in Deutschland brauchen und nur so die Möglichkeit haben, exzellente Studien auf hohem Niveau zu verwirklichen. Wünschenswert wäre, dass die Plattform mehr Geld zur Verfügung hat und noch mehr interdisziplinäre Projekte fördern kann. Über die Zoonosenplattform können Projekte beantragt werden, aber das Fördervolumen ist relativ limitiert. Das ist meist ein Jahr, auf 100.000 Euro begrenzt. Wenn hier mal größere Projekte, richtige Verbundprojekte, im Millionenbereich, vergleichbar mit der DFG, machbar wären, dann wäre das ein großer Fortschritt. Das muss natürlich durch die beteiligten Ministerien umgesetzt werden. Ich denke aber, dass sie auf einem guten Weg ist.
Und als zweites, dass die Zoonosenplattform auch über die deutschen Grenzen hinweg noch mehr Disziplinen vernetzt. Ich denke, das ist auch angedacht und ich finde das auch ganz wichtig: Das, was jetzt in Deutschland gut funktioniert – Veterinäre, Humanmediziner, Klimaforscher und Biologen zu vernetzen – kann man nun auf ein europäisches Level übertragen. Denn da kenne ich diese gute Vernetzung noch nicht, da ist jeder ein bisschen für sich, nicht so wie in unserer Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen. Vielleicht könnte man dann auch international Vorreiter sein, das wäre wirklich wünschenswert.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Christina Sartori für die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen.