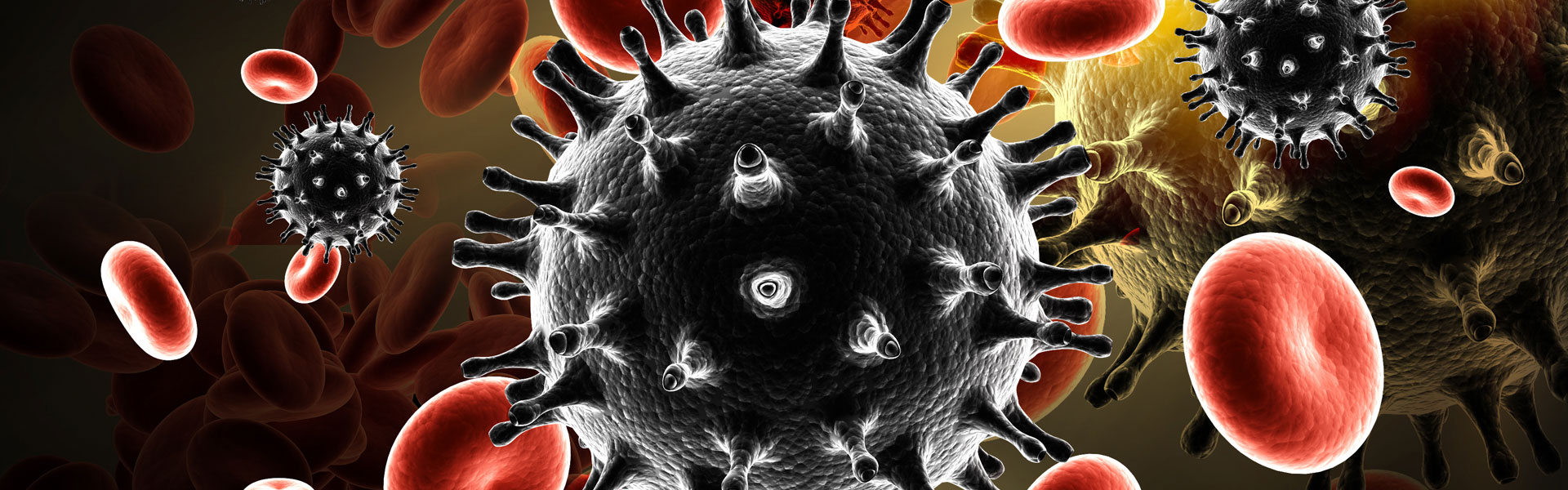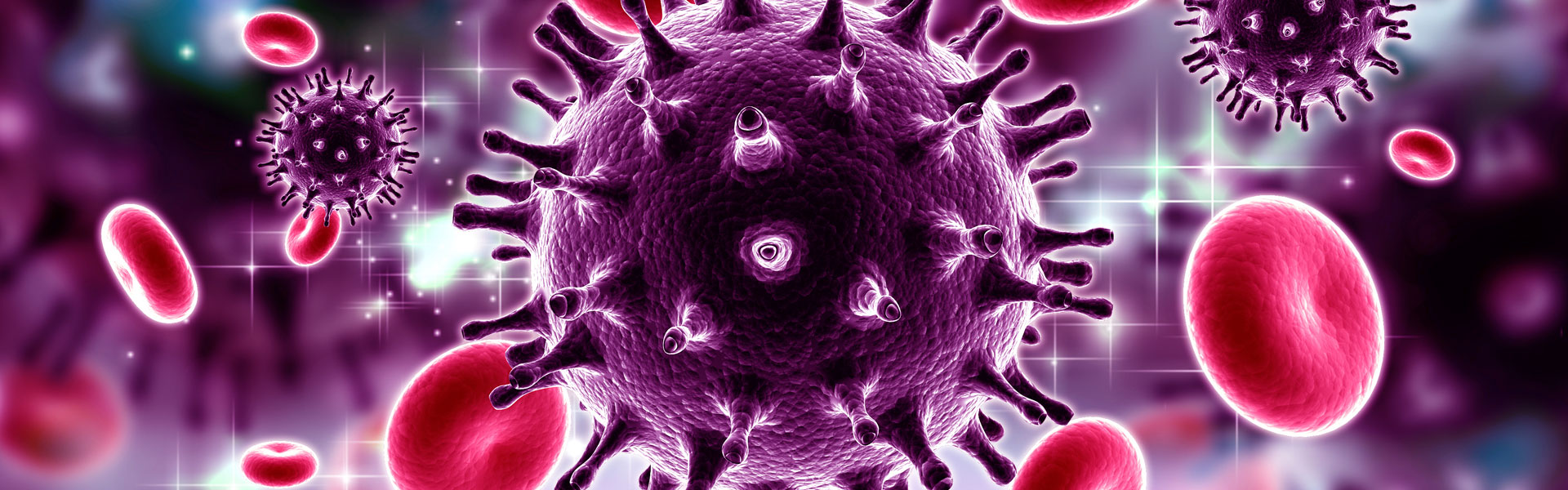Die Wissenschaftskommunikation ist essentiell, um Erkenntnisgewinne der Gesellschaft nutzbar zu machen und um fundierte Entscheidungen im Alltag aber auch auf politischer Ebene zu ermöglichen. Dies wird in einer Krise, wie einer Pandemie, besonders deutlich. In Anbetracht der hohen Relevanz des Themas lud die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen junge Wissenschaftler*innen zum Workshop „Herausforderung Wissenschaftskommunikation“ ein, auf dem sie sich mit drei Profis auf diesem Gebiet, Kathrin Zinkant (Süddeutsche Zeitung), Elke Reinking (Friederich-Loeffler-Institut) und Prof. Christian Drosten (Charité – Universitätsmedizin Berlin), austauschen konnten.

Früh übt sich, wer Wissenschaftskommunikator*in werden will
Die Coronavirus-Pandemie hat viele Dinge entschleunigt und in den Hintergrund rücken lassen - nicht so die Wissenschaftskommunikation. In der Pandemie, in der viele Fragen nach wie vor offen sind, ist die Expertise von Wissenschaftler*innen gefragt wie nie. Dabei hat sich gezeigt, dass die Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten und Methoden keineswegs trivial ist. Der Workshop „Herausforderung Wissenschaftskommunikation“ sollte daher jungen Wissenschaftler*innen die Möglichkeit geben, sich bereits früh in ihrer Karriere mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Aus diesem Grund bekamen die Teilnehmenden im Online-Workshop drei verschiedene Perspektiven geboten: die Sicht einer Wissenschaftsjournalistin, einer Pressestelle eines Forschungsinstitutes und eines kommunizierenden Wissenschaftlers.
Verbündeter statt Feind?! – der Wissenschaftsjournalismus
Frau Kathrin Zinkant, studierte Biochemikerin und Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, wies in ihrem Beitrag darauf hin, dass es „die Medien“ nicht gebe. Die Formate und Herangehensweisen würden sich in der Medienlandschaft stark unterscheiden. Bei der Süddeutschen Zeitung sei die Besetzung des Wissensressorts mit einem 10-köpfigen Team noch relativ breit aufgestellt. Allerdings sei der Stellenwert des Wissenschaftsjournalismus in den letzten Jahren in Deutschland spürbar gesunken, was sich nun in der Pandemie umso deutlicher bemerkbar mache. Die Geschwindigkeit der Themen hingegen habe, auch aufgrund digitaler Medien, auf schwindelerregende Weise zugenommen. Diese Sturzflut an neuen Inhalten könne auch manchmal den Journalismus vor sich hertreiben und dabei ein Gefühl von Bewusstseins- und Kontrollverlust vermitteln. Frau Zinkant bemühte sich, den im Journalismus herrschenden Druck zu erklären, der gelegentlich an die Wissenschaftler*innen in Form von Zeitdruck weitergegeben werde. Sie warb für mehr Verständnis für den Wissenschaftsjournalismus und wünsche sich für die Zukunft mehr Vertrauen von Wissenschaftler*innen in diesen Berufsstand. Dass irreführende Schlagzeilen kontraproduktiv sein können, sei nachvollziehbar. Aber Frau Zinkant riet den jungen Forschenden ihre Scheu gegenüber den Medien abzulegen. Wissenschaftsjournalisten seien keine Gegner und hätten nicht das Ziel, Forscher*innen vorzuführen. Für die Zukunft warb sie für mehr Schnittstellen zwischen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaft, wie beispielsweise beim Science Media Center (SMC). Twitter auf der anderen Seite schätzte Frau Zinkant nicht als valide Informationsquelle ein. Lediglich die dort zu findenden Hinweise auf wissenschaftliche Studien seien manchmal bei der Recherchearbeit hilfreich. Am Ende sei die Qualität ihrer Arbeit aber immer von den ihr zur Verfügung stehenden Quellen abhängig, und das seien nun mal zum großen Teil kommunizierende Wissenschaftler*innen. Es leuchtet ein, dass die Qualität des Endresultates, also des Medienbeitrags, direkt von der Qualität des Ausgangsstoffes, also den Informationen aus der Wissenschaft, abhängig ist.
Pufferzone zwischen Wissenschaft und Gesellschaft – die Pressestelle
Die Hauptaufgabe der Wissenschaft ist allerdings immer noch die Forschung. Daher unterhalten die meisten größeren Forschungseinrichtungen in Deutschland eine Pressestelle, die den Forscher*innen bei der Kommunikation unterstützend zur Seite steht. Einblicke in die Aufgaben und Arbeitsweisen einer Pressestelle gab Frau Elke Reinking, diplomierte Biologin und Leiterin der Pressestelle am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). In seiner Rolle als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit sei die Kommunikation nach außen, aber auch nach innen, eine wichtige Aufgabe des FLIs. Bei einem Institut mit ca. 850 Angestellten und verschiedenen Standorten sei das kein leichtes Unterfangen, da sich auch die Medienlandschaft durch die Digitalen Medien in den letzten Jahren verändert habe. Auch das FLI zählt deshalb seit 2019 einen Twitter-Account zu seinen Kommunikationskanälen. Die Tweet-Frequenz eines Donald Trump erreicht das FLI allerdings nicht, was daran liegt, dass der Kanal ausschließlich für die Verbreitung ausgewählter, fachlicher Inhalte zum Einsatz kommt. In seiner Haupttätigkeit beantwortet die Pressestelle am FLI Presseanfragen unterschiedlichster Medien. Im Jahr 2020 trafen dort bereits mehr als 1.000 dieser Anfragen ein. Die von Frau Zinkant zuvor erwähnten, unterschiedlichen Formen des Journalismus kennt Frau Reinking daher gut. Dies drücke sich zum einen in unterschiedlichen Umgangsformen aus, aber auch in den aus Pressemitteilungen entstehenden Artikeln. Eine Auswahl verschiedener Schlagzeilen, die sich alle auf die gleiche Pressemitteilung des FLIs bezogen, verdeutlichte das eindrücklich. Dennoch zieht Frau Reinking für ca. 95 % der mit der Presse gemachten Erfahrungen ein positives Fazit. Jungen Wissenschaftler*innen riet sie, ähnlich wie Frau Zinkant, keine Angst vor Wissenschaftskommunikation zu haben. Zumal die Wissenschaftler*innen an den meisten Instituten eine erfahrene Pressestelle als Anlaufstelle hätten, bei der sie sich kompetente Beratung und Unterstützung holen könnten.
Der verantwortungsvolle Umgang mit Wissen – der kommunizierende Wissenschaftler
Aber warum sollte ein/e Wissenschaftler*in eigentlich kommunizieren? Hat er/sie nicht eigentlich „besseres zu tun“? Ein Wissenschaftler, der darauf eine Antwort geben kann, ist Prof. Christian Drosten. Der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin ist ein anerkannter Coronavirus-Experte und wurde in den vergangenen Monaten nicht müde, sein Wissen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Er tue dies zum einen, da die Finanzierung aus öffentlichen Geldern auch eine gesellschaftliche Verpflichtung mit sich bringe. Zum anderen sei es aber auch Aufgabe eines Experten, sich falschen Aussagen immer wieder entgegen zu stellen und Verkürzungen in den richtigen Kontext einzuordnen. Die Erfahrungen, die er als kommunizierender Forscher gemacht habe, seien sehr unterschiedlich. Insbesondere in Bezug auf die Reaktionen der Öffentlichkeit – von „Bombendrohungen bis Sachertorten“ war alles mit dabei. Besonders heftige Reaktionen bezögen sich aber meist nicht auf wissenschaftliche Aussagen, sondern vielmehr auf die Politisierung dieser. Mit der Zeit habe er Vieles lernen können. So sei zum Beispiel die Zitierweise im Journalismus sehr anders als in der Forschung. Während die Wissenschaft immer bemüht sei, die Primärquelle für eine Aussage zu zitieren, beriefen sich viele Medien nur auf Sekundärquellen ohne eigene Quellenrecherche. Den Effekt, den das haben kann, haben viele in ihrer Kindheit bei dem Spiel „Stille Post“ erleben können. Die Zeit habe ihn auch vorsichtiger werden lassen, so Prof. Drosten. Dies läge vor allem an der Autoritätsrolle, die man in den Medien zugesprochen bekommt. Für jede Aussage, die man in der Öffentlichkeit trifft, trägt man die Verantwortung - das sollte man sich als kommunizierender Wissenschaftler*in immer wieder klar machen. Das beinhalte auch, als Kommunikator bewusst Missverständnisse zu vermeiden oder diese frühzeitig auszuräumen und die Grenzen des eigenen Wissens sehr deutlich zu machen.
Wie Frau Zinkant beobachtet auch Prof. Drosten eine Beschleunigung durch die digitalen Medien. Den dabei erlebten Kontrollverlust des Journalismus selbst führte er auf einen Verlust der Selbstreflektion zurück, für die aufgrund des hohen Tempos oft keine Zeit bleibe. Auf der anderen Seite böten die Digitalen Medien auch neue Möglichkeiten, wie beispielsweise das Format des Podcasts, in dem komplexe Zusammenhänge mit ausreichend Zeit erklärt werden können.
Am Schluss nannte Prof. Drosten noch einige Kriterien, die in seinen Augen eine „gute“ Wissenschaftskommunikation ausmachen würden. Dazu zähle zuallererst den Schritt in die Öffentlichkeit nur dann zu machen, wenn man ausreichend Expertise hat und auch tatsächlich etwas Neues zu seinem eigenen Fachgebiet oder dem „facheigenen Nahfeld“ zu sagen habe. Zum anderen müsse es immer um fachliche Inhalte gehen, nicht um die eigene Person. Dazu zähle auch, weder populistisch noch populär zu agieren. Das sei ein Grund warum er ein Podcastformat einem Fernsehauftritt vorzieht. Wie seine Vorrednerinnen, empfahl auch Prof. Drosten jungen Wissenschaftler*innen, unter Wahrung der genannten Kriterien den Schritt in die Öffentlichkeit nicht zu scheuen. Seiner Einschätzung nach eignen sich hierfür insbesondere Kanäle wie Twitter, wo man mit Bildern Einblicke in den Laboralltag geben könne. Besonders zu Beginn solcher Aktivitäten sei es sinnvoll, eigene Kommunikationsaktivitäten mit den jeweiligen Arbeitsgruppenleiter*innen abzustimmen.
Die Wissenschaftjournalistin Kathrin Zinkant (unten links), die Pressestellenleiterin am FLI Elke Reinking (unten rechts) und der Virologe Christian Drosten (oben rechts) teilten beim Workshop ihre Erfahrungen online mit den Nachwuchswissenschaftler*innen. Fragen aus dem Publikum leitete die Moderatorin Dana Thal (Nationale Forschungsplattform für Zoonosen, oben links) an die Redner*innen weiter.
Bühne frei für wissenschaftliche Erkenntnisse
Der Workshop zeigte auf eindrückliche Weise wie die einzelnen Akteur*innen der Wissenschaftskommunikation – Journalismus, Pressestelle, Wissenschaft – sich zwar teils in ihren Perspektiven und Arbeitsweisen unterscheiden können, wie sie jedoch am Ende alle voneinander abhängen und gemeinsame Motive verfolgen können. Guter Wissenschaftsjournalismus ist auf kommunizierende Wissenschaftler*innen angewiesen. Die Pressestelle kann hierbei eine Brückenfunktion einnehmen. Für junge Wissenschaftler*innen gilt es, sich früh mit den einzelnen Akteur*innen der Wissenschaftskommunikation auseinander zu setzten und keine unnötige Scheu gegenüber diesem Thema aufzubauen. Dabei sollte jedoch klar sein: ein guter Weg zur Selbstdarstellung ist das Ganze nicht, denn im Mittelpunkt sollte immer die Forschung stehen und nicht der*die Forschende.
Text: Dr. Dana Thal für die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen
Weiterführende Links: