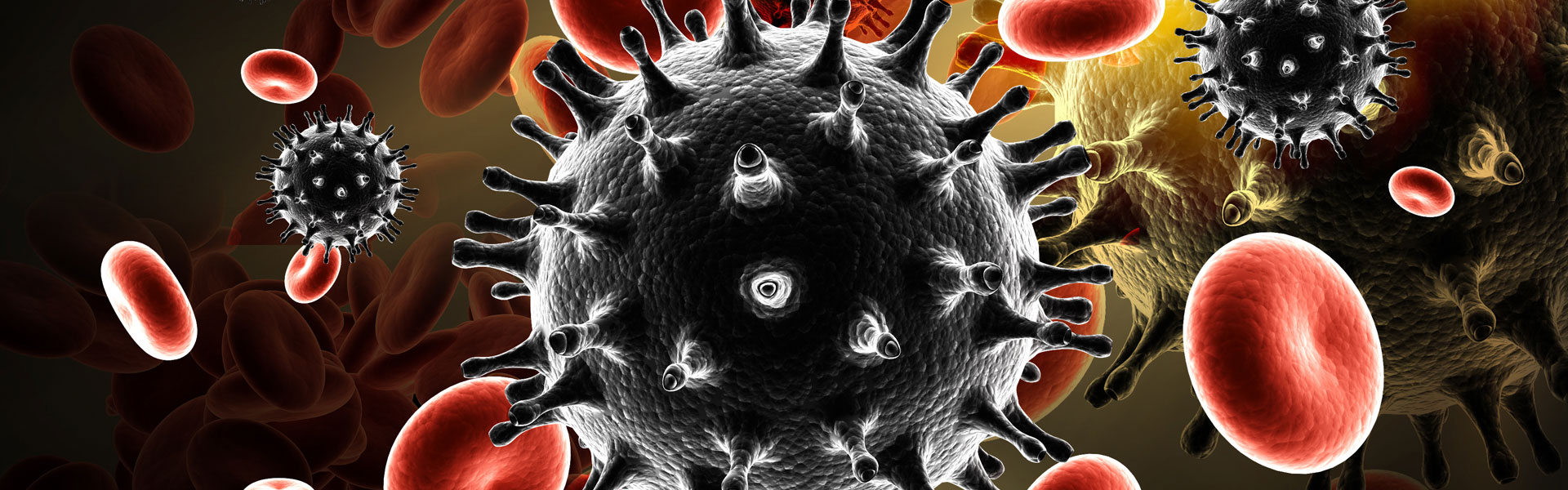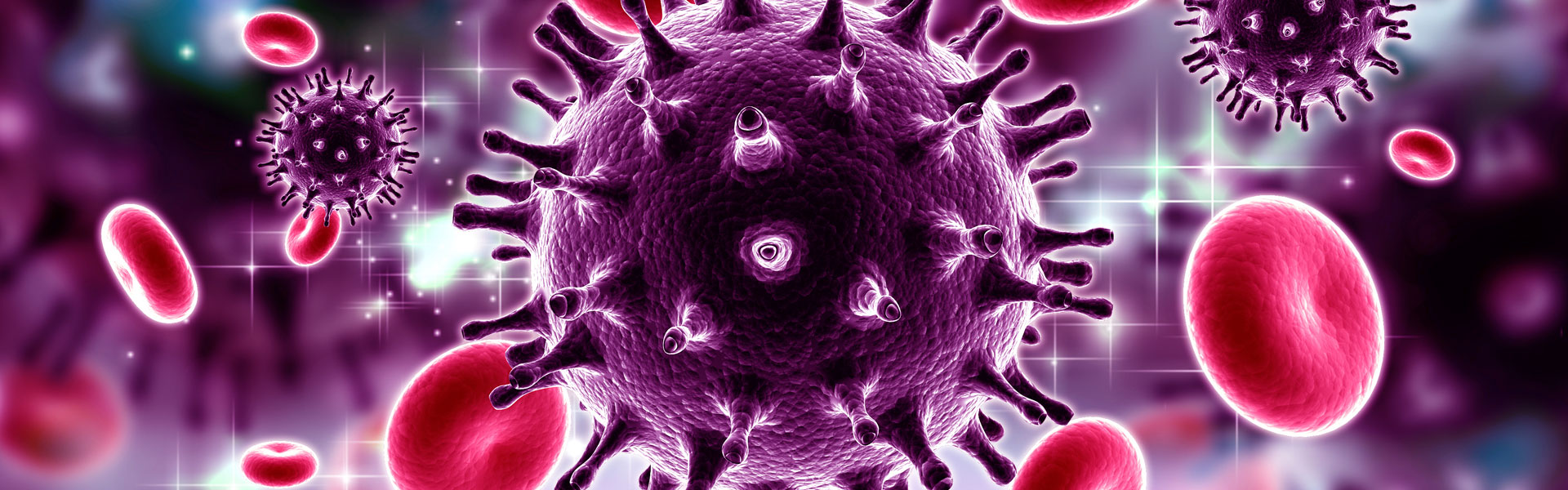Vorsicht doppeldeutig!
Meldepflicht! Anzeigepflicht! Jeder Tierarzt oder Arzt, der das hört, denkt, er weiß genau, wovon die Rede ist. Aber obwohl es sowohl in der Human- als auch in der Tiermedizin Meldepflichten gibt, haben die Wörter teilweise eine unterschiedliche Bedeutung. In der Human- als auch in der Tiermedizin wird das Wort „Meldepflicht“ routinemäßig benutzt – aber unterschiedlich gebraucht. Und das kann gelegentlich zu Verwirrungen führen, etwa wenn das Gesundheitsamt, im Falle eines Seuchenausbruchs auf einem Landwirtschaftshof, mit einer Veterinärmedizinerin oder einem Veterinärmediziner redet. Wir schaffen einmal Klarheit.
Das Infektionsschutzgesetz regelt die Meldepflicht in der Humanmedizin, in den Paragraphen 6 und 7. Dort ist die Meldepflicht von Krankheiten und Krankheitserregern definiert. Abhängig davon, wer etwas entdeckt: Ein Arzt etwa entdeckt eine Krankheit, aber der Erreger wird im Labor diagnostiziert. Meldepflichtig sind Krankheiten, die das Potenzial haben, große Verheerungen anzurichten, wie Ebola und die Masern, aber auch Polio und Covid-19. Die Meldepflichten haben zum Ziel, dass der Staat daraus bestimmte Maßnahmen ableiten kann, die der Bekämpfung und Vorbeugung einer Krankheit dienen, die als gefährlich eingestuft wird. Diese Meldung geht dann an das Gesundheitsamt und an das Robert-Koch-Institut.
In der Tiermedizin ist es zwar ähnlich, im Detail aber doch anders. Dort wird unterschieden zwischen meldepflichtigen Tierkrankheiten und anzeigepflichtigen Tierseuchen – was im Tiergesundheit-Gesetz geregelt ist. Das Relevante, Wichtige ist dort die Anzeigepflicht. Auf die – schon seit langem elektronische - Anzeige einer Tierseuche folgt eine behördliche Intervention - weil die Krankheit tödlich ist oder wirtschaftliche Konsequenzen hat oder eine Zoonose ist und damit einen Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben könnte. Ist die Seuche per Anzeigepflicht gemeldet, beginnen die Behörden unmittelbar mit Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention. Hierbei sind die behördlichen Befugnisse sehr weitreichend.
Das bedeutet, dass Grundrechte eingeschränkt werden können. Etwa freie Fortbewegung - weil ein Sperrbezirk einrichtet wird. Der Warenverkehr kann eingeschränkt werden. Tiere können gekeult werden, um die Verbreitung der Seuche zu unterbinden. Die Tierhalter dürfen gegen diese Maßnahme zwar klagen, sie dürfen sich ihnen aber nicht entziehen.
Die Anzeigepflicht wird nur in der Tiermedizin verwendet. Die zugrundeliegende Erkrankung ist so relevant und potenziell gefährlich, dass nicht nur der Tierarzt die Pflicht zur Anzeige hat, sondern alle, die mit diesen Tieren zu tun haben. Egal, ob das der Halter ist oder ein Nutzer, wie etwa Angler, Jäger oder Lebensmittelkontrolleure. Selbst Transporteure oder deren Beifahrer müssen den Verdacht einer Tierseuche anzeigen. Und selbstverständlich auch Tierärzte und Leiter tierärztlicher oder sonstiger öffentlicher oder privater Untersuchungs- oder Forschungseinrichtungen.
Die Anzeigepflicht in der Veterinärmedizin ist damit das Äquivalent der Meldepflicht in der Humanmedizin.
Allerdings gibt es auch meldepflichtige Tierkrankheiten.
Die Meldepflicht in der Tiermedizin dient jedoch nicht der direkten Seuchenbekämpfung und hat nicht die Dringlichkeit der Anzeigepflicht. Meldepflichtige Tierkrankheiten sind eher harmlos. Man überwacht sie dennoch, weil es gut ist, zu wissen, wie oft diese Krankheiten auftreten oder ob sie eingeschleppt werden. Dabei geht es eher um Monitoring, etwa: Funktionieren die Programme zur Eindämmung? Wirkt die Impfung? Taucht die Krankheit regional verstärkt auf? Die Meldepflicht in der Tiermedizin ist ein mildes Werkzeug, da keine Gefahr im Verzug ist.
Der gleiche Begriff wird also unterschiedlich benutzt. Weil es Erkrankungen gibt, die sowohl den tiermedizinischen als auch den humanmedizinischen Bereich betreffen, wie etwa die Tollwut, ist das nicht immer ganz glücklich, da es zu Verwechslungsgefahr führen kann.