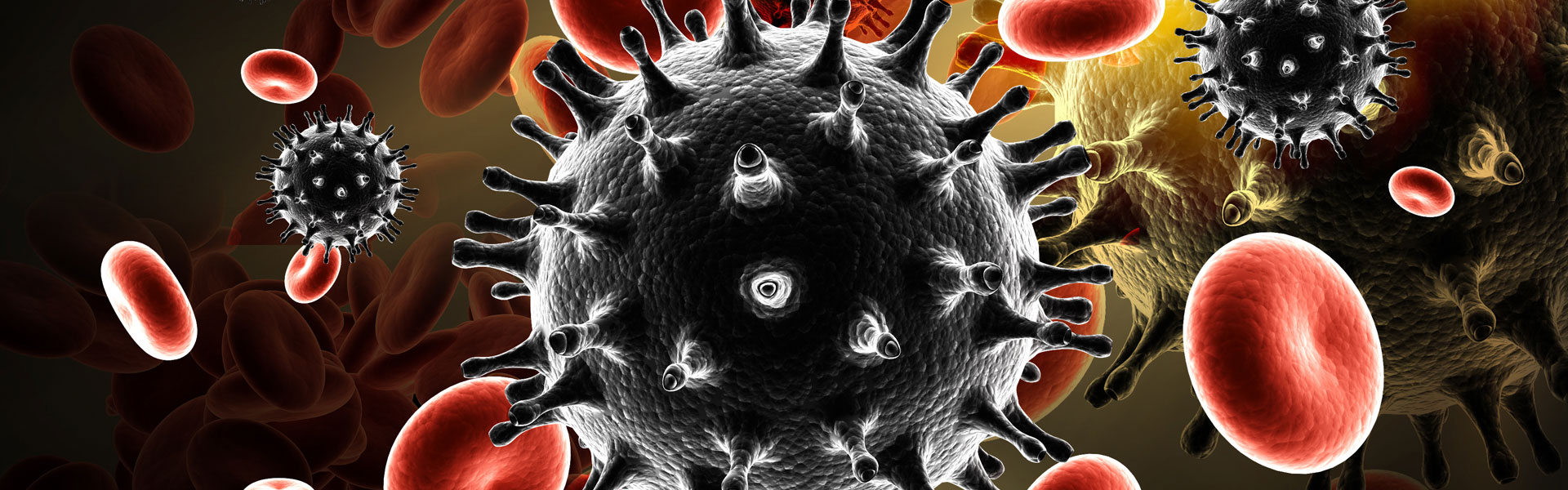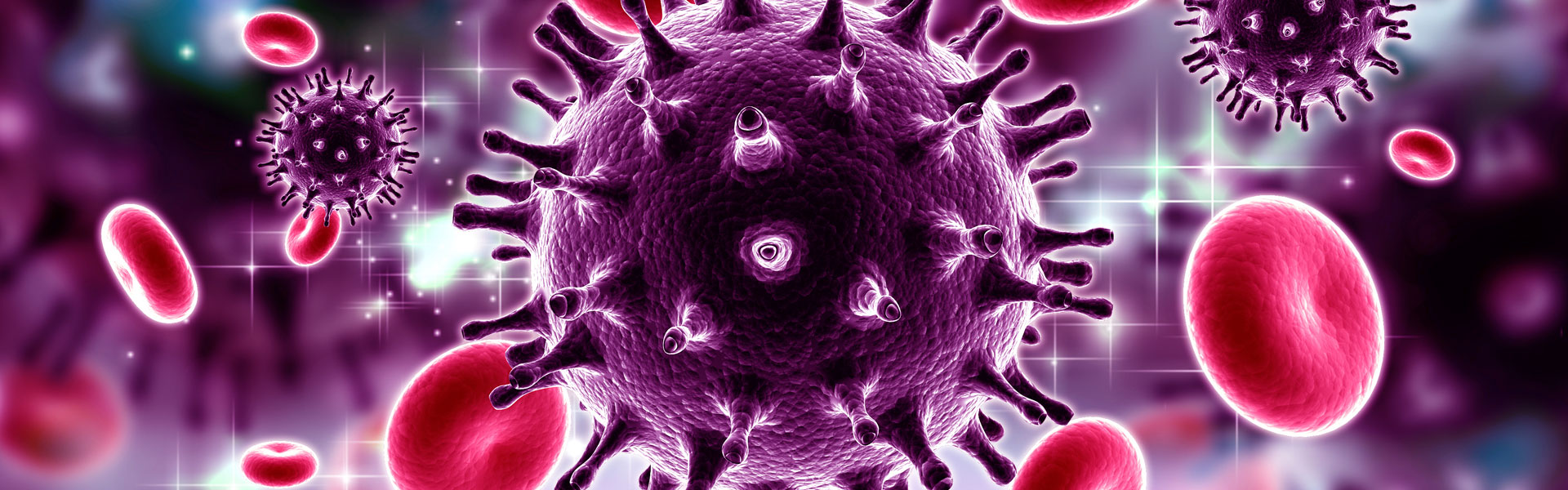7 Fragen an … Dr. Martin Blume
Am Robert Koch-Institut leitet Dr. Martin Blume eine JRG (Junior Research Group) zum Metabolismus mikrobieller Krankheitserreger. Innerhalb des Forschungsnetzes Zoonotischer Infektionskrankheiten leitet er die Nachwuchsgruppe Toxo, die sich mit dem Parasiten Toxoplasma gondii auseinandersetzt.
Seit wann ist Toxoplasma gondii Ihr Forschungsschwerpunkt?
Ich beschäftige mich seit 2007 mit dem Parasiten. Seit rund 14 Jahren forsche ich also an Toxoplasma gondii. Und damit bereits seit meiner Diplomarbeit: Ursprünglich habe ich Biophysik studiert. Nachdem ich alle Prüfungen und Scheine zusammen hatte, suchte ich nach einem Thema für meine Diplomarbeit – und stieß dabei auf den Parasiten.
Wie kamen Sie dazu, sich mit dem Erreger zu beschäftigen?
Was ich in meiner Arbeit untersuchen wollte, war die Frage, wie Biophysik in einer Zelle funktioniert. Bestimmte Transportermoleküle spielen bei der chemischen Unterscheidung zwischen dem Intrazellulären und dem Extrazellulären eine entscheidende Rolle. Auf diesen Transportern lag mein Interesse. Ich fand eine Ausschreibung zu einem Transporterprojekt an dem Einzeller Toxoplasma gondii, der zuvor nicht unbedingt meine Aufmerksamkeit geweckt hatte – der mich aber dann sehr schnell faszinierte, weil er zeitgleich einen Modellorganismus darstellt und auch für die öffentliche Gesundheit relevant ist.
Was ist das Besondere oder sogar Faszinierende an dem Parasiten?
Toxoplasma gondii hat so etwas wie eine Sonderstellung innerhalb der Parasiten. Es gibt eine hohe Anzahl an Parasiten, die sehr auf ihre Wirte spezialisiert sind und teilweise sogar ausschließlich bestimmte Organe oder Zelltypen in diesen Wirten infizieren. Toxoplasma gondii hingegen ist eine äußerst erfolgreiche Lebensform, die alle Warmblüter infiziert, von Robben über Vögel bis hin zu Nutztieren und Menschen und im Prinzip jede Zelle infizieren kann. Gleichzeitig ist er stark angepasst, denn er lässt seinen Wirt in den meisten Fällen nicht erkranken. In Südamerika, wo vielleicht sein Ursprungsort liegt, gibt es mehrere hundert, teils sehr virulente Stämme des Erregers, während in Europa und Nordamerika lediglich drei Hauptstämme existieren, wovon der Typ II-Stamm mit Abstand am weitesten verbreitet und für über 90 Prozent aller Infektionen verantwortlich ist.
Welches Ziel verfolgt die Nachwuchsgruppe Toxo?
Mein persönliches Interesse ist die Erforschung der Lebensweise des Parasiten. Innerhalb von Toxo haben wir das Ziel, Wirkstoffe gegen die chronischen Infektionen, die Toxoplasma gondii verursacht, zu finden. Bislang sind die chronischen Infektionen, die vor allem bei immunsupprimierten Menschen gefährlich werden, nicht behandelbar. Es gibt Medikamente, teilweise noch aus den 50er-Jahren, die gegen die akute Toxoplasmose relativ erfolgreich eingesetzt werden. Allerdings haben Sie oft starke Nebenwirkungen, so dass es häufig zu einem Behandlungsabbruch kommt. Bei unserer Suche nach neuen Wirkstoffen und dem Erforschen von deren Wirkmechanismen lernen wir natürlich viel Neues über die Physiologie und Stoffwechsel von Toxoplasma.
Gibt es einen Ansatz oder eine Idee, wie der Erreger nach seiner dauerhaften „Verkapselung“ im Körper entfernt werden könnte bzw. wie man gegen ihn vorgehen kann, damit es zu einem späteren Zeitpunkt nicht zu einer Reaktivierung kommt?
Bei einigen Versuchen wurde Mäusen das Malaria-Medikament Atovaquon verabreicht. Nach einer monatelangen Behandlung der Mäuse nahmen die verzysteten Parasiten im Gehirn zwar ab, verschwanden aber nicht vollständig. Nach Beendigung der Behandlung kann sich die verbleibende Kernpopulation wieder umgehend vermehren. In unserer Forschungsgruppe haben wir ein muskelzellbasiertes in vitro-Modell entwickelt, in dem wir menschliche Muskelzelllinien infizieren, in denen der Parasit ausgereifte und weitestgehend resistente Zysten bildet. So können wir das Modell nutzen, um den Stoffwechsel des Parasiten zu untersuchen und Wirkstoffe zu testen. Mehr als 600 Substanzen haben wir bereits getestet, und eine Handvoll davon scheint gegen die chronischen Formen gut zu wirken. Jetzt müssen wir herausfinden, auf welche Weise diese Stoffe wirken und ob sich diese Wirkung auch in vivo reproduzieren lässt.
Toxoplasma gondii wurde immer wieder mit Verhaltensänderungen beim Menschen in Verbindung gebracht. Gibt es hier eine verlässliche Datenlage oder neue Erkenntnisse, dass der Erreger tatsächlich Einfluss auf die Psyche des Menschen hat?
Bei Studien mit Menschen kann im Wesentlichen nur die Seropositivität nachgewiesen werden. Diese Studien haben also gemessene Antikörper im Blut zur Grundlage. Wie viele Zysten sich aber tatsächlich im Gehirn befinden, kann man daraus nicht schließen. Darüber hinaus sind solche Studien von sehr vielen Parametern, die auf vielfältige Weise miteinander korrelieren können, abhängig. Oft angeführt wird der Zusammenhang mit einer Schizophrenie-Erkrankung: Das Risiko an Schizophrenie zu erkranken scheint jedoch im Alter zu steigen, genauso wie das Risiko einer Toxoplasma-Infektion oder anderen Alterungserscheinungen. Ein kausaler Zusammenhang ergibt sich daraus deshalb noch nicht. Es gibt daher viele Faktoren, die unklar bleiben.
Welches Projekt oder welche Studie steht bei Toxo aktuell an?
Das Metabolom im Parasiten, die Gesamtheit der kleinen Moleküle, wie z.B. Zucker, Aminosäuren und Vitamine, konnten wir durch unser in vitro-Modell erstmals sehr hoch aufgelöst messen. Über einhundert verschiedene Metabolite konnten wir messen – und haben hier einige Überraschungen gefunden. Zum Beispiel kommen im Parasiten Kofaktoren vor, sogenannte Carnitine, die bei der Fettverbrennung des Menschen eine Rolle spielen. Eigentlich besitzt der Parasit diesen Stoffwechselweg nicht, dennoch finden wir die Moleküle, die daran beteiligt sind, in ihm. Die Relevanz dieser Carnitine, gilt es jetzt herauszufinden. Eventuell können so bereits zugelassene Medikamente, die die Carnitine beeinflussen, gegen eine chronische Infektion mit dem Erreger helfen.
Das Gespräch führte Christoph Kohlhöfer