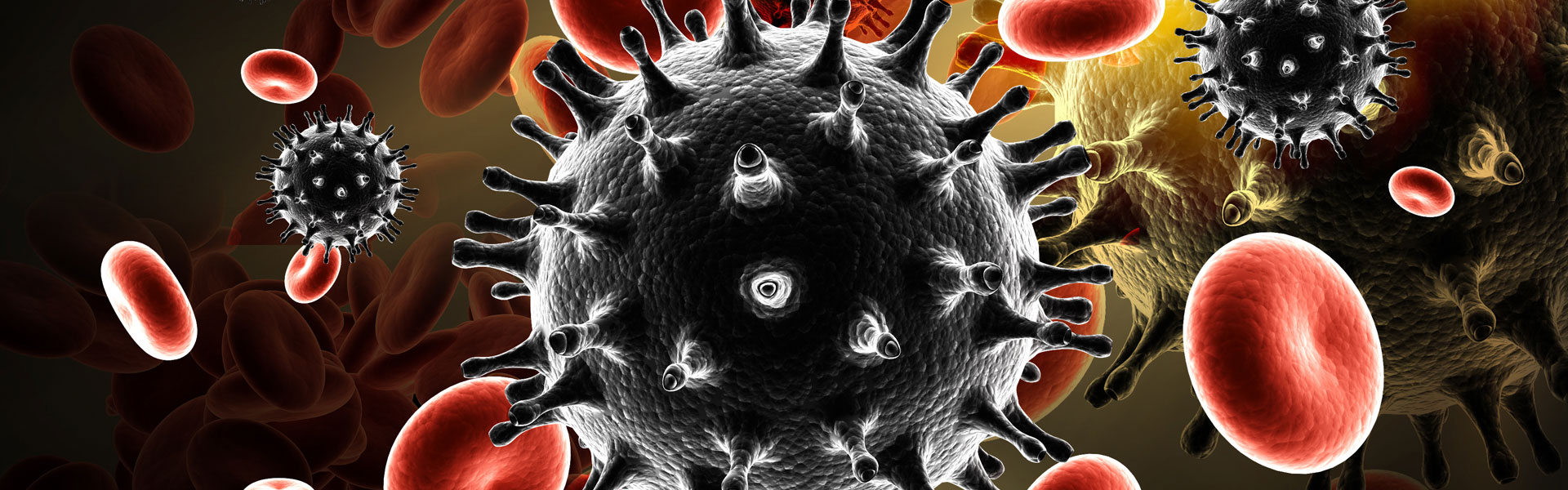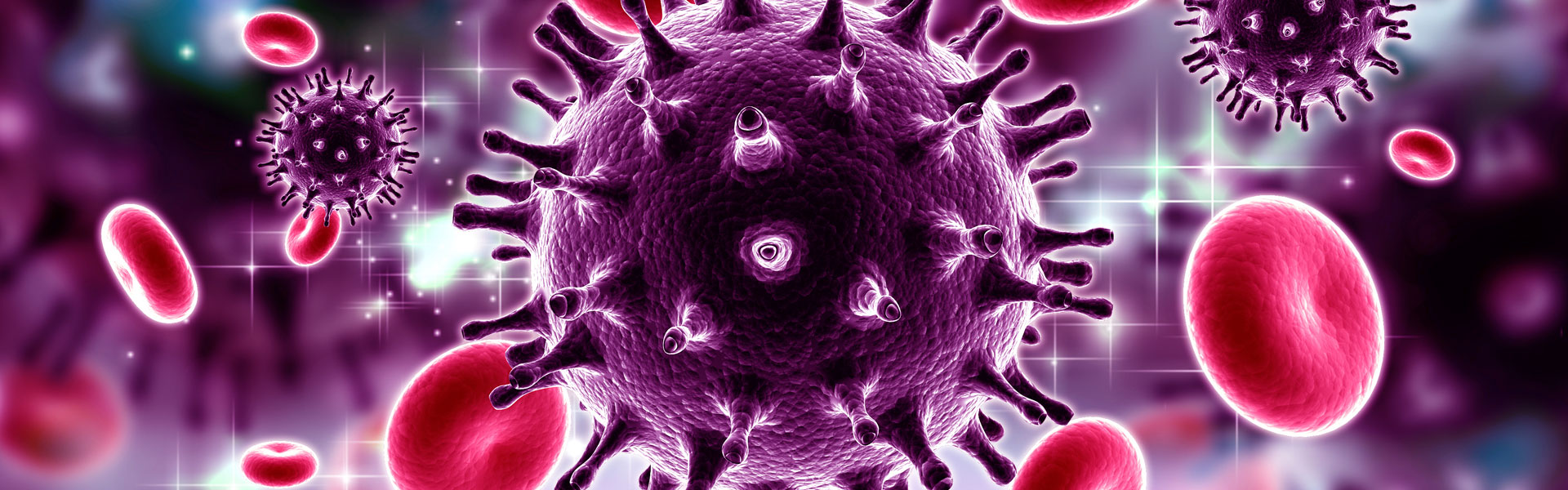Katzen, Mettbrötchen und Verhaltensänderungen
Rund 15 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten. Katzenfotos in sozialen Medien erreichen regelmäßig die höchsten Aufmerksamkeitswerte. Eindeutig: Die Katze ist hierzulande das beliebteste Haustier. Beliebt ist sie aber nicht nur bei uns Menschen, auch ein Parasit hat sich ihrer angenommen. Sein Name: Toxoplasma gondii. Der Parasit, der ein entfernter Verwandter der Malaria-Erreger ist, gelangt über Umwege auch in den menschlichen Körper, in dem er sich dauerhaft einrichtet und mitunter schwerwiegende Folgeschäden auslösen kann. Die Toxoplasmose, die er verursacht, ist eine weltweit häufig vorkommende Infektionskrankheit. Ein Umweg, den der Einzeller dabei unter anderem nimmt: das in Deutschland ebenfalls sehr beliebte Mettbrötchen.
Aus evolutionsbiologischer Sicht ist Toxoplasma gondii ein Superstar. Seine Ausbreitung ist immens. In ungefähr 60 Vogel- und 300 Säugetierarten wurde er bereits nachgewiesen. Eine Säugetierart davon sind wir, der Mensch. Und gerade in Deutschland ist der Parasit nicht gerade selten verbreitet: Im Schnitt tragen ihn 50 Prozent aller Deutschen in sich. Mit zunehmendem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion, pro Lebensjahr um ca. 1 Prozent. Dennoch scheint es so, dass der Parasit in der öffentlichen Wahrnehmung eher eine Randerscheinung ist. Das mag daran liegen, dass der größte Teil aller Infektionen mild oder symptomlos verläuft. Der Infizierte bekommt nichts davon mit, dass sich gerade ein Parasit in seinem Körper vermehrt. Und wenn er etwas mitbekommt, dann meistens kurz nach der Infektion in Form von Erkältungssymptomen: Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit, geschwollene Lymphknoten. Nach wenigen Tagen sind die Symptome abgeklungen, und dem Patienten geht es wieder gut. Doch einen entscheidenden Haken gibt es dabei: Ist Toxoplasma gondii erstmal in den Körper eingedrungen, verbleibt er dort auch – und das dauerhaft.
Eine Erstinfektion mit dem Erreger ist vor allem in der Schwangerschaft gefährlich. Denn die Toxoplasmose wirkt sich erheblich auf das Ungeborene aus. Je nach Infektionszeitpunkt kann eine Infektion der Schwangeren eine Fehlgeburt zur Folge haben oder zu schweren Fehlbildungen beim Kind führen. Der umgangssprachlich „Wasserkopf“ genannte Hydrocephalus, innere Schädelverkalkungen und Augenentzündungen gehören zu den Folgen, ebenso wie Krampfanfälle, Lähmungen und Blindheit. Diese Symptome entwickeln sich oft auch in den ersten Lebensjahren nach der Geburt. Insbesondere für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann eine Toxoplasmose ernste Folgen haben. Oft entwickelt sich bei ihnen eine Lungen- oder Gehirnentzündung, die epileptische Anfälle oder Lähmungserscheinungen verursacht. Die Infektion kann schließlich einen tödlichen Verlauf nehmen. Der Unterschied zu der Infektion bei Schwangeren ist: Die Gefahr geht hier nicht von einer Erstinfektion mit dem Parasiten aus. Die Infektion kann schon viele Jahre zuvor stattgefunden haben. Denn nach der Infektion verbleibt der Erreger in Form von Zysten im Körper und kann bei einer Immunschwäche reaktiviert werden. Aber auch bei Menschen mit einem funktionierenden Immunsystem kann die Toxoplasmose plötzlich wieder ausbrechen und eine Augenentzündung auslösen, die unbehandelt zur Erblindung führt.
Der „Heimatort“ des Parasiten ist der Darm der Katze, die Katze ist also sein Endwirt. In Deutschland sind je nach Region zwischen 45 und 75 Prozent aller Hauskatzen infiziert. Im Katzendarm, so könnte man sagen, fühlt sich Toxoplasma gondii ziemlich wohl, denn ausschließlich hier vermehrt er sich sexuell und produziert Nachkommen. Bis zu zwei Wochen lang scheidet eine infizierte Katze mit ihrem Kot pro Tag mehrere Millionen Eier, die sogenannten Oozysten, aus. Diese reifen im Freien, sind extrem umweltstabil und bleiben Monate lang hochinfektiös. Über die Umwelt, beziehungsweise die Nahrungsaufnahme, gelangt der Erreger so in die Körper von Vögeln und Säugetieren. Im Darm des Zwischenwirts angekommen werden aus den Oozysten Tachyzoiten. Der Parasit vermehrt sich ab jetzt rasant intrazellulär durch Teilung. Doch das Immunsystem des Zwischenwirts reagiert umgehend und drängt den Eindringling zurück. Spezifische Antikörper werden gegen den Erreger gebildet. Dieser hat allerdings eine geschickte Strategie parat: Aus den Tachyzoiten werden Bradyzoiten, die ihren Stoffwechsel herunterfahren, sich in Zysten ansammeln und ins Gewebe des Zwischenwirts zurückziehen. Wie genau die Eigenheiten dieses Stoffwechsels aussehen und wie der Parasit auf Antimikrobiotika reagiert, erforscht die Nachwuchsgruppe Toxo, die Teil des Forschungsnetzes Zoonotische Infektionskrankheiten ist. Basierend auf den Forschungsergebnissen können Erkenntnisse zur medikamentösen Behandlung einer chronischen Infektion gewonnen werden.
Die Infektion beim Menschen kann direkt über den Katzenkot erfolgen, etwa bei der Reinigung des Katzenklos oder wenn eine infizierte Katze ihr Geschäft im Gemüsebeet verrichtet hat und das Gemüse vor der weiteren Verarbeitung in der Küche nicht genügend gewaschen wird. Eine weitere Infektionsquelle beim Menschen ist jedoch der Verzehr von rohen oder nicht genügend durchgegarten Fleisch- und Wurstwaren. Wenn sich der Parasit in Form von Zysten im Gewebe von Schwein, Rind, Geflügel und Lamm befindet, nehmen wir ihn beim Verzehr des Fleisches, etwa beim Genuss eines Mettbrötchens, auf.
Nach oraler Aufnahme durchdringt Toxoplasma gondii innerhalb von nur wenigen Stunden die Darmwand und infiziert Muskel-, Nerven- und Immunzellen. Die Immunzellen spielen dabei eine besondere Rolle, denn mit ihrer Hilfe reist der Erreger durch den gesamten Körper und überwindet dabei auch die Blut-Hirn-Schranke – so gelangen er nicht nur etwa in Lunge und Herz, sondern auch ins Gehirn. Ob der Erreger im menschlichen Gehirn Auswirkungen auf das Verhalten oder gar psychische Erkrankungen hat, ist umstritten. Die Datenlage hierzu ist noch schwach. Im Mäusegehirn jedoch beeinflusst er durch eine Ansammlung von Gewebezysten in der Amygdala das Verhalten der infizierten Maus auf eine besonders perfide Art: Die Maus fühlt sich von Katzenurin angezogen und verliert die Angst vor der Katze. Was für die Katze praktisch ist, ist es auch für den Parasiten – denn so gelangt er wieder in den Darm seines Endwirtes.
Quellen:
- https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Toxoplasmose.html
- https://www.apotheken-umschau.de/Toxoplasmose
- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/T/Toxoplasmose/Toxoplasma_gondii_in_Deutschland.html
- https://www.bfr.bund.de/de/toxoplasmen__toxoplasma_gondii_-54398.html
- https://www.aerzteblatt.de/archiv/208347/Toxoplasmose-in-Deutschland
- https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/neuroparasiten-100.html
- https://www.spektrum.de/magazin/toxoplasma-wie-ein-parasit-gehirne-manipuliert/1360141